Das war das lösungsfokussierte Summer Retreat 2021

Lösungsfokussiertes Summer Retreat – Arbeitsurlaub am Irrsee Bereits zum zweiten Mal fand dieses Jahr das SF Summer Retreat am oberösterreichischen Irrsee statt. Dort trafen wir uns mit insgesamt 18 Absolventinnen und Absolventen bzw. aktuellen Teilnehmenden unseres Ausbildungslehrgangs zum Lösungsfokussierten Coachen und Beraten, die aus Deutschland, der Schweiz und Österreich angereist sind. Wir haben gemeinsam gearbeitet, […]
4 Tipps für deine Neujahrsvorsätze

Alle Jahre wieder ist es ein beliebter Brauch, mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu starten. Heute Nacht haben wir sogar einen Jahrzehnt-Wechsel vor uns. Wie sieht es aus? Sind deine Neujahrsvorsätze schon formuliert? Wir möchten dir heute ein paar Überlegungen mit ins neue Jahr geben, wie du die Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzung schon alleine durch […]
Selbstorganisation in agilen Teams und darüber hinaus

In vielen Schriften zum Thema Agilität heißt es, das Besondere an agilen Teams sei u.a. deren Fähigkeit (und Möglichkeit) zur Selbstorganisation. Das klingt meist so, als ob die Teams vor der „Agilisierung“ nicht selbstorganisierend gewesen wären. Doch Selbstorganisation findet ständig statt – in allen Teams! Sich selbst organisierende Systeme Einer unserer Kunden wünschte sich von […]
Ausbildung zum „Lösungsfokussierten Coachen und Beraten“

Im September 2018 startete der erste Durchgang des sinnvollFÜHREN-Ausbildungslehrgangs für „Lösungsfokussiertes Coachen und Beraten“ in Wien. Die Idee dazu gibt es schon lange. Jetzt freuen wir uns riesig auf die Realisierung dieses großen Traums! Ins Kurs-Konzept, in die Auswahl der Trainerinnen und Trainer, ins Finden der richtigen Location und auch in die Einladung zur Teilnahme […]
Coaching in der modernen Führung

Coaching in der modernen Führung ist Toolkit Nummer Eins, folgt man den Vorträgen auf einschlägigen Konferenzen und Blogartikeln zum Thema. Das ist auch durchaus passend, wenn man bestimmte Regeln und Grenzen beachtet. Der missverstandene und daher falsche Einsatz von Coaching-Tools kann hingegen zu nachhaltiger Verschlechterung der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden führen. Wir möchten hier […]
Laterale Führung – Die helle Seite der Macht

Derzeit entstehen in vielen Organisationen und Vereinen vermehrt netzwerkartige Formen der Zusammenarbeit. Thematisch relevante Expertinnen und Experten kooperieren dort in Projekten unabhängig von ihrer jeweiligen hierarchischen Zugehörigkeit. Das Sagen haben in diesen Netzwerken jene, die sich auskennen. Führungskonzepte, die auf formaler Rangordnung basieren, stoßen hier rasch an ihre Grenzen. Grund genug, sich Laterale Führung als […]
Sicherheit und Sinn – Die heimlichen Gründerväter von sinnvollFÜHREN

sinnvollFÜHREN – Den Namen haben wir für unser kleines Unternehmen aus mehreren Gründen ausgewählt – und sind damit heute, nach knapp 2 Jahren unseres Bestehens, glücklicher, als wir es jemals erhoffen konnten. Beginnen wir von ganz vorne: Sicherheit und Sinn SINN Viktor Franks Lehre hat mich 2008 erreicht, als meine liebe Freundin und Kollegin Sabine […]
Teilen macht reich – Mehr ist noch nicht genug!
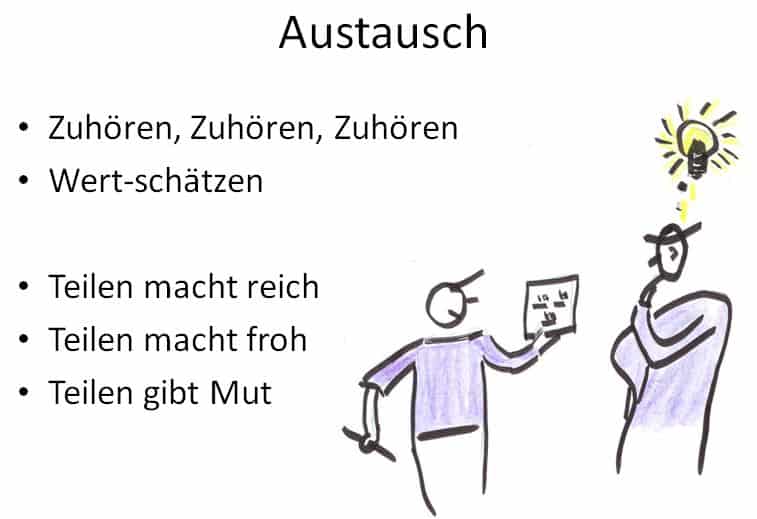
Mut teilen Im letzten Beitrag ging es schon um das Thema „Teilen macht reich. Und noch viel mehr.“ Wenn ich damals geahnt hätte, was dieser Beitrag bewirken würde, wäre ich vielleicht vorsichtiger gewesen… Was war passiert? Nur zwei Tage nach dem Schreiben des Blogbeitrages bin ich aufgewacht und wusste: Ich hatte einen klaren Auftrag, nämlich […]
Teilen macht reich – Und noch viel mehr

Teilen macht reich Eigentlich wollte ich den“Teilen macht reich“ Blogbeitrag schon am 16. Februar schreiben, … heute klappt es endlich: Am 16. Februar habe ich folgende E-Mail erhalten: Hallo Werner, vielen Dank für Deine Informationen und vor allem auch für den offenen Termin. Ich spüre wie gut mir so ein Firmen-übergreifender Austausch tut und konnte […]
Retrospektive (fast) „nach“ Ralph

Im letzten Gast-Blogbeitrag habe ich kurz von einer Retrospektive berichtet, in deren Verlauf ich an meine erste Begegnung mit Ralph und den Folgen denken musste: „Weg mit den Ishikawas“. Nun haben mich einige Menschen angesprochen, die wissen wollten, wie denn die Retrospektive gelaufen ist. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hier der […]
